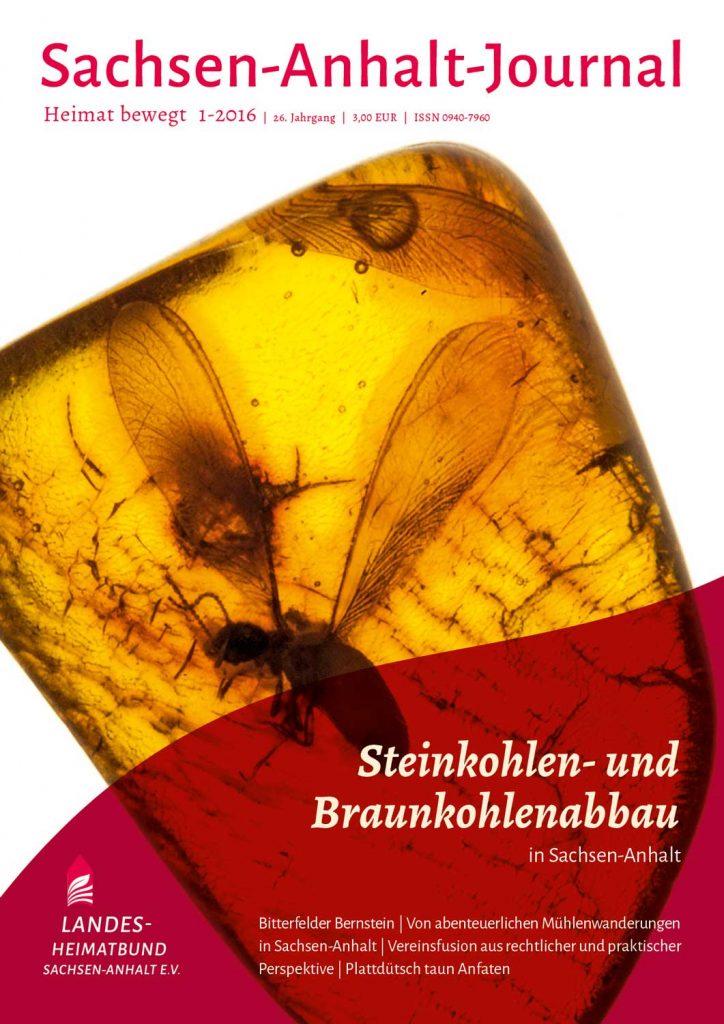Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt vom 18. Jahrhundert bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 –33.
Ein kurzer Überblick
von Peter Hertner | Ausgabe 1-2016 | Geschichte
Der heutige Betrachter wird, wenn er die technische und räumliche Entwicklung des Bergbaus in Mitteleuropa vom Hochmittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts verfolgt, von dessen Vielfalt beeindruckt sein. Fast jede Region war vertreten, auch wenn in den Jahrhunderten vor der industriellen Revolution im Vergleich zu heute selbst kleinste Vorkommen, soweit das technisch möglich war, bereits abgebaut und meist gleich an Ort und Stelle verwertet wurden. Mitteleuropäische Schwerpunkte gab es aber auch bereits in Mittelalter und Frühneuzeit. Zwei Arten historischer Rohstoffvorkommen im Bundesland Sachsen-Anhalt, deren Ausbeutung und Verwertung sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
- Der Steinkohlenbergbau
In der unmittelbaren Gegenwart wird der Steinkohlenbergbau in Deutschland im Laufe der nächsten Jahre aus seinem letzten noch ausgebeuteten Revier an Ruhr und Niederrhein verschwinden. Der Grund für diesen Rückzug ist im internationalen Vergleich nicht nur in der Kostenentwicklung beim Abbau der noch vorhandenen Vorkommen, sondern vor allem auch im wachsenden Widerstand gegen die Umweltbelastung bei der Verwendung dieses gleichzeitigen Rohmaterials und Brennstoffs zu suchen.
Im südlichen Teil des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt lässt sich der Bergbau auf Steinkohle schon in vereinzelten Erwähnungen von Vorkommen bei Wettin – nördlich von Halle an der Saale gelegen – aus dem späten 14. und dann aus dem 15. und 16. ahrhundert nachweisen. Im 18. Jahrhundert kommen dann noch Löbejün und Dölau als Abbauorte hinzu, auch wenn es sich bei den spätmittelalterlichen Hinweisen auf Kohle gelegentlich um Braunkohlevorkommen gehandelt haben könnte.[1] Um Wettin herum zählt man für das Jahr 1695 immerhin 12 Steinkohlengruben, auch wenn deren jeweilige Ausmaße bescheiden gewesen sein dürften.[2] Wilhelm Pieper zufolge „ … beträgt [um 1790] die Jahresförderung von Wettin 2400, von Löbejün 2000, von Dölau 900 Wispel. Verwendet wird die Steinkohle zum Salzsieden, Stubenheizen, Salpetersieden usw., und die Wettiner Kohle ferner vorzüglich zum Schmieden, wozu die Löbejüner Kohle gar nicht brauchbar ist.“[3] Kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts war in Wettin und im benachbarten Löbejün der Höhepunkt der Steinkohlenförderung erreicht, an beiden Orten wurden spätestens ab 1863 Dampfmaschinen für die Wasserhaltung und Förderung eingesetzt. Die wichtigsten Kunden waren im 18. und 19. Jahrhundert die Salinen in Halle und Staßfurt sowie die Hütten des Mansfelder Kupferschieferbergbaus und teilweise auch die Thüringische Eisenbahn. „Nach 1872 war die Förderung rückläufig, und 1874 förderte das Wettiner Revier letztmalig mit einer positiven Bilanz“.[4] In Löbejün wurde der Steinkohlenabbau bereits 1883, in Wettin genau zehn Jahre später eingestellt.[5]
In Löbejüns Nachbarort Plötz, der bis 1815 zu Kursachsen gehörte, wurden Steinkohlen sporadisch schon im 18. Jahrhundert abgebaut. In größerem Umfang kam es dort zur Kohlenförderung erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts. 1884 erfolgte in Plötz die Gründung der Aktiengesellschaft Steinkohlenwerk Plötz, einer Initiative privaten Kapitals, die hier vor allem von den Steinkohlelieferungen an die damals noch relativ zahlreichen Zuckerfabriken im provinzialsächsischen Umkreis profitierte. In Wettin und Löbejün hingegen war die Kohleförderung fiskalisch, d. h. vom brandenburg-
preußischen Staat organisiert und versorgte, wie bereits oben erwähnt, vor allem auch die staatlichen Salinen.[6] Eine Konkurrenz durch die Ruhrkohle oder die Steinkohle aus Oberschlesien hatte das Steinkohlenwerk Plötz auch noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts wegen der vergleichsweise schlechten Verkehrsverhältnisse „kaum zu befürchten“. Es lieferte seine Kohle in eine relativ kleine Zone in einem Umfeld von etwa 20 km. Allerdings reduzierte die großflächige Elektrifizierung in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts den Absatzmarkt für die Steinkohlen aus Plötz.[7]
1919 wurde dort auf drei Sohlen in 60, 80 und 120 m Tiefe mit einer Belegschaft von 240 Mann, davon 80 über Tage, Kohle gefördert. 1928 waren es schon 413 Bergleute, die in diesem Jahr 58.000 t Kohle gewannen. Vorübergehend, so im Kriegsjahr 1942, konnte die Förderung bis auf etwa 80.000 t gesteigert werden.[8] Seit dem 1. Juli 1948 wurde das Steinkohlenwerk Plötz als „selbständiger volkseigener Betrieb“ geführt. Knapp zwei Jahrzehnte später, im Jahr 1967, legte man das Unternehmen in Plötz still. Seine Wirtschaftlichkeit ließ sich auch unter den Bedingungen einer zentral gesteuerten Wirtschaftsordnung nicht mehr garantieren.[9]
Sieht man einmal von dem hier erwähnten Schwerpunkt der Steinkohlenförderung im Raum Wettin-Löbejün-Plötz ab, so lassen sich Abbauversuche in und um Halle nur gelegentlich vom 17. bis 19. Jahrhundert nachweisen. Dasselbe gilt für den nördlichen Harzrand bei Meisdorf in der Nähe von Ballenstedt im 18. und 19. Jahrhundert. Mit den im Laufe des 19. Jahrhunderts massiv ausgebauten Förderregionen an Ruhr und Saar, im Aachener Gebiet und in Oberschlesien, selbst mit den Vorkommen in der Zwickauer Region lassen sich die doch recht kleinen Fundgebiete in der preußischen Provinz Sachsen jedenfalls nicht vergleichen, auch wenn sie für die örtliche Versorgung zeitweise von Bedeutung gewesen sind.
- Der Braunkohlenabbau
Ein ungleich größeres Gewicht kam – im 19. und 20. Jahrhundert – dem Abbau der Braunkohle auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt zu. Einen exzellenten Gesamtüberblick liefert dazu Hans Otto Gericke mit seiner 2002 vom Landesheimatbund veröffentlichten Darstellung der historischen Entwicklung des Braunkohlenabbaus auf dem Gebiet der früheren preußischen Provinz Sachsen und der von ihr umschlossenen anhaltischen Gebiete.[10] Gericke zeigt gleich zu Anfang seiner Darstellung auf, dass im Allgemeinen eine klare Unterscheidung zwischen der Steinkohle als dem erdgeschichtlich älteren und der Braunkohle, dem deutlich jüngeren Sediment, „erst zum Ausgang des 18. Jahrhunderts“ getroffen wurde. Im Vergleich zur Steinkohle lag die Braunkohle „überwiegend in oberflächennahen Sedimenten“[11], sie war weniger komprimiert – also in der Regel weicher – , hatte einen relativ hohen Wassergehalt und verfügte im Gegensatz zur Steinkohle (7000 – 8200 kcal pro kg) über einen deutlich geringeren Heizwert: er lag bei etwa 2500 kcal pro kg für die Braunkohle aus dem Raum Halle-Merseburg-Bitterfeld, bei 2800 kcal pro kg für die Braunkohle, die im Raum Magdeburg-Helmstedt gefördert wurde.[12] Betrachtet man Deutschland innerhalb seiner heutigen Grenzen, dann wurde Braunkohle im 19. und 20. Jahrhundert vor allem auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt, im Rheinland, in der Niederlausitz, in Sachsen und im nördlichen Hessen abgebaut.
Angesichts steigender Brennholzpreise gingen die Salinen in Halle, Staßfurt und Schönebeck in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in wachsendem Maße dazu über, Steinkohle aus Wettin oder Löbejün beim Salzsieden einzusetzen. Auf Dauer war das Angebot an Steinkohle in diesem Gebiet allerdings zu begrenzt, so dass sich in der zweiten Jahrhunderthälfte eine zunehmende Nutzung der Braunkohle, insbesondere in den staatlichen Salinen, anbot.[13]
Nach 1815 stieg in der neu gebildeten preußischen Provinz Sachsen die Förderung von Braunkohle – verstärkt vor allem in den späten 1820er Jahren – kontinuierlich an. Gericke macht dafür besonders die rasch zunehmende Zahl der Zuckerrübenfabriken verantwortlich, die sich ab Mitte des Jahrhunderts noch einmal schneller erhöhte. Insbesondere in der Magdeburger Börde sei die Zahl der Verarbeiter, und damit auch die Nachfrage nach Energie aus der Braunkohle, in den folgenden beiden Jahrzehnten gestiegen.[14] „Waren es 1837/38 in der Provinz Sachsen und Anhalt bereits 40 Zuckerfabriken, so wuchs deren Zahl bis 1872 auf 178, was 60 Prozent aller in Deutschland damals entstandenen Anlagen waren.“[15]
Kurz vor der Jahrhundertmitte, im Jahr 1847, belief sich Gericke zufolge der Anteil der Braunkohlen-Förderung in der preußischen Provinz Sachsen insgesamt an der Fördermenge dieses Energieträgers im gesamten preußischen Staat auf 74,19 %. Im Südteil der Provinz, dem Regierungsbezirk Merseburg, wurde zu diesem Zeitpunkt ein Anteil von 56,86 % an der gesamtpreußischen Förderung gemessen.[16] Die 1850er und 1860er Jahre waren durch erste Konzentrationsprozesse bei der Förderung und bei der Verarbeitung gekennzeichnet, so dass so genannte „konsolidierte Gruben“ beziehungsweise „konsolidierte Gewerkschaften“ entstanden.[17] Parallel dazu wuchs in diesen beiden Jahrzehnten gerade auch in Mitteldeutschland ein Netz von Eisenbahnlinien, das neue Möglichkeiten des Wettbewerbs eröffnete, wie sie bis dahin gerade zwischen den einzelnen Braunkohlengruben meist unbekannt gewesen waren.[18]
Die 1850er und 1860er Jahre brachten jedoch nicht nur der Braunkohle den endgültigen Durchbruch als Brennstoff für die heranwachsende mitteldeutsche Industrie. In diesen beiden Jahrzehnten wurde auch im Süden der Provinz Sachsen ein neues Angebot dort geschaffen, wo besonders bitumenhaltige Braunkohle gefördert werden konnte, aus der sich Teer, Leuchtöl und Paraffin – Rohstoffe und Zusatzstoffe für eine allmählich heranwachsende chemische Industrie – gewinnen ließen. Ein erstes Zentrum für diese Produktion bildete sich zwischen Weißenfels und Zeitz heraus, in späteren Jahren kamen auch noch die Gegend unmittelbar westlich von Halle und einige Schwerpunkte nördlich davon bis ins Anhaltische Territorium dazu, weil eben nur an diesen Orten eine solche vielseitig verwendbare Art der Braunkohle vorkam.[19] Führend bei der Entwicklung dieser neuen Industriesparte war der für die Region bedeutende Unternehmer Carl Adolph Riebeck (1821–1883). Nach dessen Tod führte die 1889 gegründete A. Riebeckschen Montanwerke Aktiengesellschaft dessen Erbe als „das größte Braunkohlenunternehmen Mitteldeutschlands“ fort.[20]
Die technische Weiterentwicklung im Braunkohlensektor kann hier nur angedeutet werden: Riebeck gründete in den 1870er Jahren bereits eine Reihe von Fabriken für die Herstellung von Braunkohlenbriketts. Das Brikett konnte aber erst im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts endgültig für die Massenherstellung tauglich gemacht werden. Damit griff es „…infolge seiner hohen Widerstandsfähigkeit für den Transport im Zusammenhang mit dem Ausbau des Verkehrsnetzes stark über das bisherige Absatzgebiet und den Rahmen der Provinz hinaus. Erst jetzt war die Zeit für den Großbetrieb gekommen …“.[21]
Diese Tendenz zum Großbetrieb setzte sich bei der Braunkohle spätestens dann durch, als der Tiefbaubetrieb, der um 1900 auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt noch dominierte, in der Folgezeit zunehmend durch den Tagebau abgelöst wurde. Der Tagebau wurde in größerem Umfang technisch möglich und zugleich rentabel durch den Einsatz von dampfgetriebenen Baggern, die zunächst nur den Abraum beseitigten, in den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs aber zunehmend beim Abbau der Braunkohle selbst eingesetzt wurden.[22]
Im letzten Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg wurden die in den Städten und auch in einer zunehmenden Zahl kleinerer Gemeinden der Provinz Sachsen und Anhalts seit den 1890er Jahren installierten elektrischen Anlagen in steigendem Maße auf Braunkohle als Energielieferanten umgestellt. In Bitterfeld und Umgebung war es bereits 1893/94 zur Gründung eines elektrochemischen Schwerpunkts gekommen, an dem die Chemische Fabrik Griesheim und, zunächst als Konkurrent, auch die AEG in vorderster Linie beteiligt waren. Die umfangreichen Braunkohlevorkommen rings um Bitterfeld hatten dafür in erster Linie den Ausschlag gegeben.[23] Im südwestlich von Merseburg gelegenen Geiseltal erlaubten erst um die Jahrhundertwende die inzwischen deutlich verbesserte Bohrtechnik und der „Einsatz moderner Elektropumpen und leistungsfähiger Bagger“ die erfolgreiche Gründung großer Tagebaubetriebe, welche noch vor 1914 mit „Spitzenförderleistungen“ aufwarten konnten.[24] Es war deshalb auch kein Zufall, dass 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, unter Leitung der BASF bei Leuna mit dem Bau eines Werkes für die Ammoniaksynthese nach dem Haber-Bosch-Verfahren begonnen wurde, das den Engpass, der durch den Ausfall der Lieferungen von Chilesalpeter während des Krieges entstanden war, entschärfen sollte. Für die Herstellung von Munition, aber auch für die schwierige Düngemittelversorgung der Landwirtschaft in Kriegszeiten war dies ein Projekt von fundamentaler Bedeutung.[25] Der gewählte Standort bei Leuna war weit von den Kriegsschauplätzen entfernt, die Eisenbahnverbindungen waren gut, Wasser war aus der unweit gelegenen Saale zu entnehmen und die benötigte Kohle ließ sich aus dem nur 5 – 10 km entfernten Geiseltal herbeischaffen.
Als Folge des verlorenen Krieges büßte das Deutsche Reich durch die Abtretung eines großen Teils des oberschlesischen Kohlenreviers und die vorläufige Abtretung des Saarlandes etwa ein Viertel seiner Steinkohlenproduktion ein. Als Ersatz kam kurz- und mittelfristig nur die Braunkohle in Frage.[26] In der Provinz Sachsen wurde das Übergewicht des südlichen Bezirks Merseburg noch dominierender: etwa 90 % der Braunkohlenförderung in der gesamten Provinz stammten in den Zwanziger Jahren aus diesem Bezirk, der Rest kam aus dem Regierungsbezirk Magdeburg. Anhalt fiel in diesen Jahren sogar auf das Niveau von etwa 3 % der Braunkohlenförderung im Merseburger Bezirk zurück.[27]
Die schwere Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 – 33 hinterließ in Deutschland gerade auch beim Verbrauch von Braunkohle in der Industrie und in den Haushalten deutliche Spuren: Bereits von 1929 bis 1930 ging der Braunkohlenabsatz beim so genannten „Hausbrand“ um 24,7 %, bei der Industrie insgesamt um 20,7 % und bei den Kraftwerken um 6,7 % zurück. „Der Fall in die Talsohle hielt jedoch bis 1933 an, als der Absatz nur noch die Hälfte der früheren Spitzenwerte [der 1920er Jahre, P.H.] erreichte.“[28]
Relativ gesehen war die gesamtdeutsche Bedeutung der Braunkohlenindustrie in der Provinz Sachsen und in Anhalt im Vergleich zur Förderung um die Mitte des 19. Jahrhunderts schon zu Beginn der 1920er Jahre deutlich geschrumpft: Sie betrug jetzt nur noch ein Drittel, hatte also ihre frühere Spitzenstellung eingebüßt. Zehn Jahre später lagen die Provinz Sachsen und Anhalt etwa auf gleicher Höhe mit dem rheinischen Braunkohlenrevier und mit dem Niederlausitzer Braunkohlengebiet.[29]
Der technische Fortschritt machte sich nach dem Ersten Weltkrieg in der mitteldeutschen Braunkohlenindustrie in ganz neuen Größenordnungen bemerkbar. Bei dem sich rasch ausdehnenden Tagebau konnten nun viel größere und leistungsfähigere Fördergeräte eingesetzt werden, und damit wurde „… endgültig die Handarbeit aus der Abraum- und Kohlengewinnung verdrängt.“ [30] Dank einer deutlich höheren Kapitalintensität konnte in der Braunkohlenindustrie der Provinz Sachsen die durchschnittliche jährliche Förderleistung bei einem in der Förderung beschäftigten Arbeiter von 1920 bis 1930 um das Dreieinhalbfache steigen.[31] Zugleich nahm die Unternehmensgröße in dieser Branche durch Konzentration und steigende Kapitalerfordernisse stetig zu.
Die Kehrseite dieser rasanten Entwicklung war eine besonders rasch steigende Umweltbelastung für Mensch und Natur. Ganze Teilbereiche von Landschaften wurden in wenigen Jahrzehnten tiefgreifend verändert, zum Teil auch regelrecht zerstört. Die spätere Rekultivierung blieb in vielen Fällen auf halbem Wege stecken, sie fiel dann den folgenden Generationen zur Last. Hinzu kam: Die Emissionen der damals neuen Industriebetriebe – vor allem in der Energiebranche und in der Großchemie – mussten sich unter den damaligen Bedingungen und beim damaligen Wissensstand zwangsläufig negativ auf die Gesundheit derer auswirken, die in diesen Betrieben oder auch nur in ihrer Umgebung beschäftigt waren und in deren Nähe zusammen mit ihren Familien wohnten.
Auch im Abstand von mittlerweile hundert und mehr Jahren wird man einerseits Hochachtung empfinden vor der Leistung der Arbeiter, Handwerker und Unternehmer, die unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen auf weiten Gebieten des heutigen Sachsen-Anhalt eine Grundstoffindustrie aufbauten, die über viele Jahrzehnte hinweg in Deutschland eine der führenden Stellungen einnahm. Andererseits wird man sich überlegen müssen, was davon geblieben ist – ob das heutige Bundesland von diesem Erbe noch zehren kann oder nur gezwungen ist, dessen überkommene Lasten allmählich abzutragen. Das sind natürlich Fragen, die sich in anderen ehemaligen Zentren der Grundstoffindustrien, zum Beispiel dem Ruhrgebiet, ebenso stellen und auch dort eine Beantwortung finden sollten.
[1] Vgl. H. Bringezu, Steinkohlenbergbau in Sachsen-Anhalt (Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 39), Halle (Landesheimatbund Sachsen-Anhalt) 2005, S. 23, 35 – 41; vgl. auch ders., Der Steinkohlenbergbau in Halle (Saale) und im Saalkreis, in: Halle und der Bergbau (Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 37), Halle (Landesheimatbund Sachsen-Anhalt) 2005, S. 187 – 220.
[2] Bringezu, Steinkohlenbergbau in Sachsen-Anhalt, a. a. O., S. 43.
[3] W. Pieper, Die Entwicklung des Kohlenbergbaus im Gebiet um Halle bis zum Bau der Eisenbahnen, in: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie, hg. v. C. Matschoss, Bd. 16 (1926), S. 133 –152 (Zitat S. 137).
[4] Bringezu, Steinkohlenbergbau in Sachsen-Anhalt, a.a. O., S. 53.
[5] 5 Ebenda, S. 54, 144.
[6] Ebenda, S. 146 ff., 166.
[7] Ebenda, S. 166 f. (Zitat S. 166).
[8] Ebenda, S. 168 –172.
[9] Ebenda, S. 194, 197 ff.
[10] H. O. Gericke, Braunkohle – einstiger Reichtum Sachsen-Anhalts. Zur Geschichte des Braunkohlenbergbaues in der ehemaligen Provinz Sachsen und dem Lande Anhalt bis 1945 (Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, hg. vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt, H. 21), Halle (Saale) 2002.
[11] Beide Zitate ebenda, S. 4.
[12] Ebenda, S. 5.
[13] Ebenda, S. 18 ff.
[14] Ebenda, S. 38.
[15] Ebenda, S. 41.
[16] Ebenda, S. 38.
[17] Ebenda, S. 48.
[18] Ebenda, S. 49 ff.
[19] Ebenda, S. 54 ff.
[20] Eine knappe Darstellung der Persönlichkeit Riebecks und seiner bemerkenswerten Unternehmerkarriere findet sich in dem Beitrag von R. Berndt, Carl Adolf Riebeck – der Mann und sein Werk in der mitteldeutschen Braunkohlenindustrie, in: Halle und der Bergbau, a. a. O., S. 372 – 377 (Zitat S. 373); vgl. dazu ebenfalls Gericke, a. a. O., S. 59 – 61. 50 Jahre nach Riebecks Tod erschien eine Gedenkschrift [P. Franke], A. Riebeck’sche Montanwerke. Die Geschichte einer mitteldeutschen Bergwerksgesellschaft, München 1933 (vgl. vor allem ebenda, S. 37 – 39 mit Landkarten der Riebeck’schen Unternehmungen im Süden des Regierungsbezirks Merseburg und im Umland von Halle).
[21] A. Zander, Die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Sachsen im 19. Jahrhundert (Rechts- und staatswiss. Diss. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Halle (Saale) 1934, S. 128.
[22] Vgl. Gericke, a. a. O., S. 102 f.
[23] Vgl. ebenda, S. 115 ff.; vgl. auch U. Mader, Emil Rathenau und die Elektrochemischen Werke (1893). Quellen und Materialien, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Jg. 1990, H. 4, 191 – 227.
[24] Gericke, a. a. O., S. 126.; vgl. auch K.-D. Bilkenroth, Von der Manufakturperiode bis zur Herausbildung der Großindustrie, 1800 bis 1924/30, in: Braunkohle in Forschung und Lehre an der Bergakademie Freiberg, Freiberg i.S. 2001, S. 61.
[25] Vgl. die detaillierte Darstellung bei G. Plumpe, Die I. G. Farbenindustrie AG. Wirtschaft, Technik und Politik 1904 –1945, Berlin 1990, S. 63 ff.
[26] Vgl. Gericke, a. a. O., S. 141 f.; vgl. auch O. Splett, Die wirtschaftliche Entwicklung des Braunkohlenbergbaues im Kreise Bitterfeld und sein Einfluß auf den dortigen Industrieaufbau, Auszug aus der Staatswiss. Diss. an der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale) 1922, S. 2.
[27] Vgl. Gericke, a. a. O., S. 144 f.
[28] Ebenda, S. 146.
[29] Ebenda, S. 151, 237 (Tabelle F).
[30] Ebenda, S. 154.
[31] Berechnet nach den Angaben in Tabelle 28 (ebenda, S. 161).