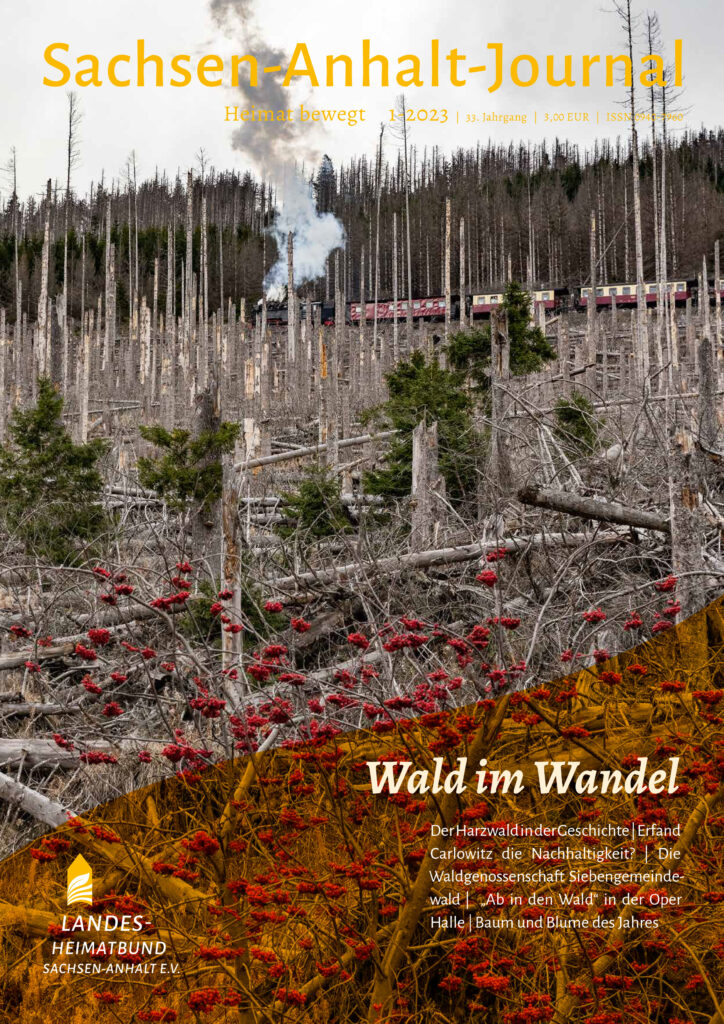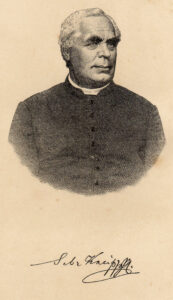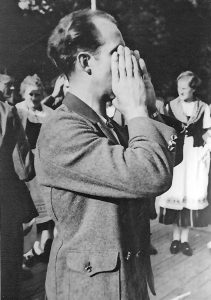VEB Burger Bekleidungswerke: Wie die Textilindustrie die sachsen-anhaltische Stadt Burg prägte
Im Mittelalter waren es Tuche, zu Zeiten der DDR waren Uniformen: die Geschichte der Stadt Burg und der Textilindustrie waren seit jeher miteinander verwoben. Heutzutage ist dieses lange Kapitel allerdings fast in Vergessenheit geraten.
Antonia Beran | 11. Mai 2023 | Ausgabe 1-2023
Die Textilindustrie hatte in der Stadt Burg eine lange Tradition. Schon im Mittelalter wurden Burger Tuchwaren geschätzt…