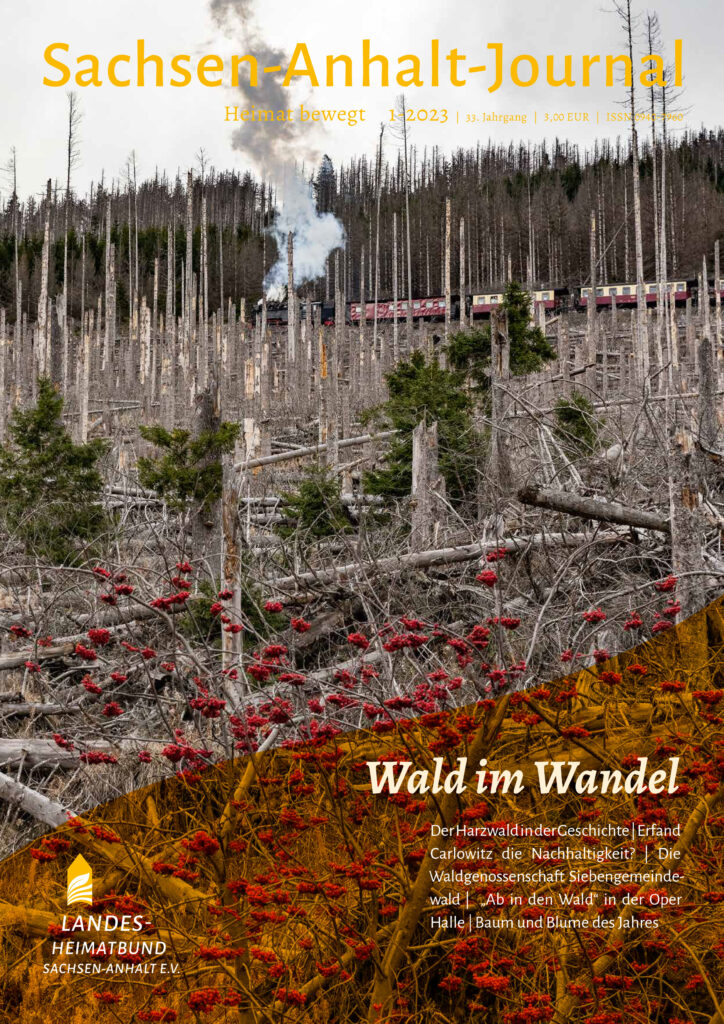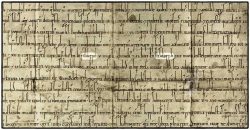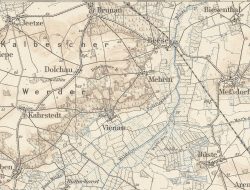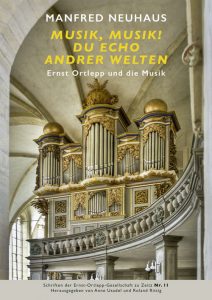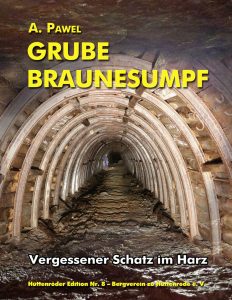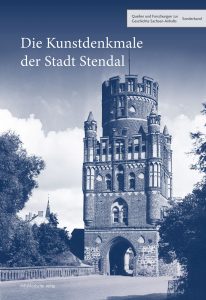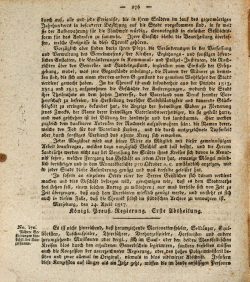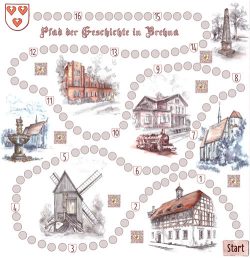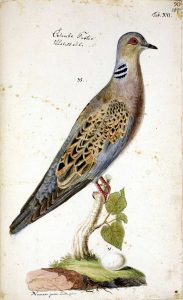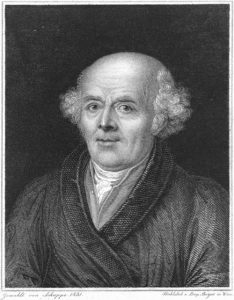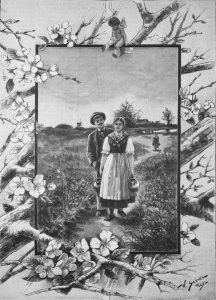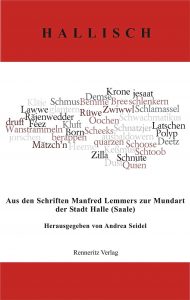Vom Gasspeicher zum Wissensspeicher – das neue Planetarium Halle (Saale)
Dirk Schlesier und Katrin Keym | 16. Februar 2022 | Ausgabe 4-2021
In Halle (Saale) wird auf der grünen Salineinsel ein neues Planetarium gebaut: unmittelbar neben einem Erholungsgebiet und doch nur wenige Gehminuten vom Zentrum von Sachsen-Anhalts größter Stadt entfernt. Der Ersatzneubau für das 2013 durch Hochwasser zerstörte Raumflug-Planetarium auf der Peißnitzinsel zwischen hallescher Alt- und Neustadt wird aus Flutmitteln des Landes finanziert. Damit erhält Halle, wie vor der Flut, wieder das größte Planetarium in Sachsen-Anhalt. Das neue Planetarium soll eine große Strahlkraft weit über die Stadtgrenze hinaus entfalten.