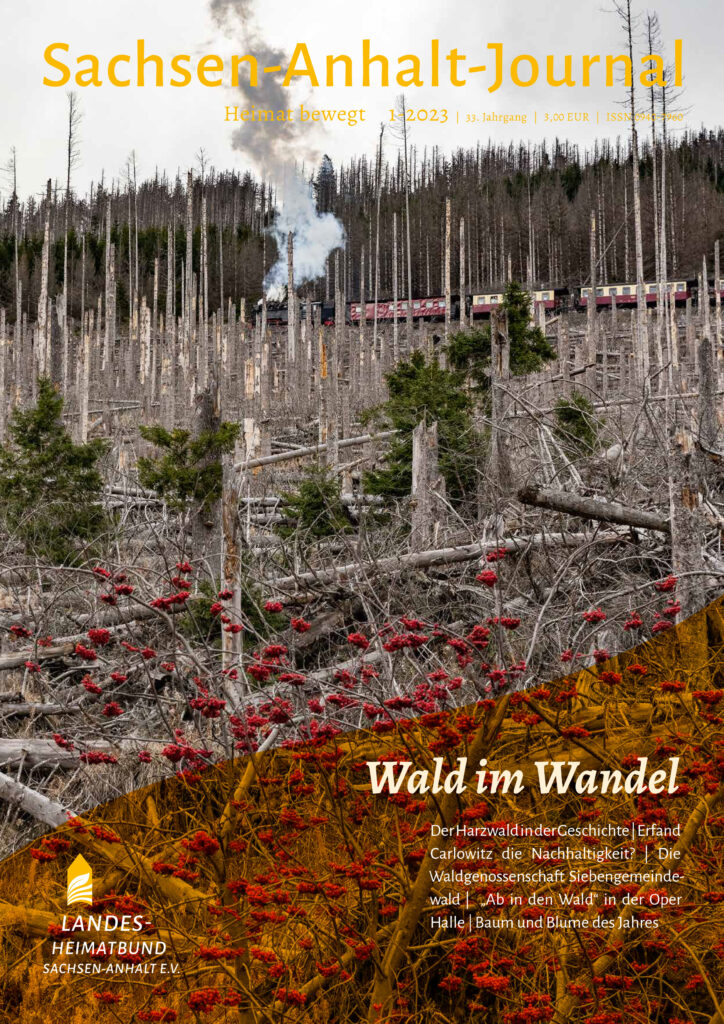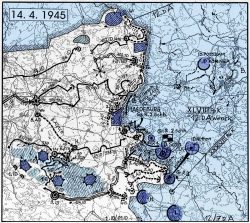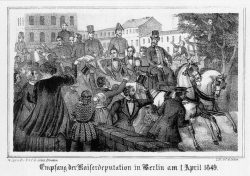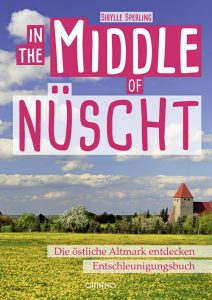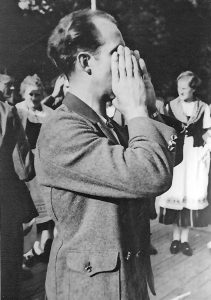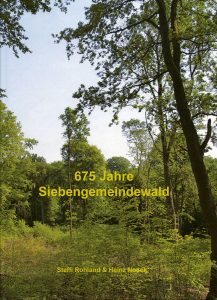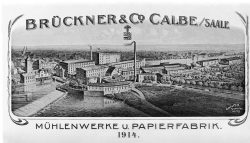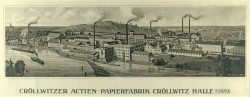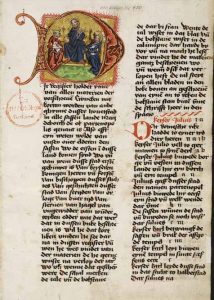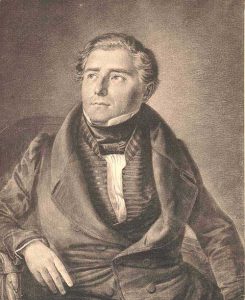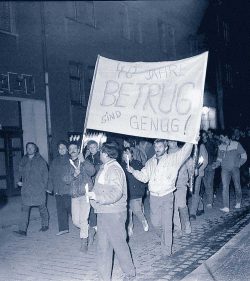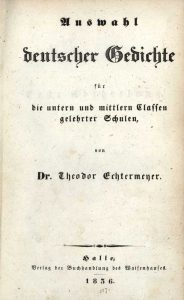»Ich habe die Grenzen überschritten«
Sonja Renner | 4. August 2020 | Ausgabe 2-2020
Interview mit Reem Alrahmoun, Engagementbotschafterin Kultur des Landes Sachsen-Anhalt. Ein Gespräch über Kultur, Toleranz und Aufgeschlossenheit sowie ihren tiefen Wunsch, mit ehrenamtlicher Arbeit Geflüchteten und insbesondere Frauen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.